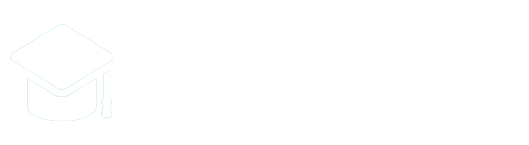Selbstständigkeit beenden: Dein Fahrplan für den Neustart
Die Selbstständigkeit aufzugeben, bedeutet einen Umbruch, der nicht nur organisatorisch einiges von dir abverlangen kann, sondern auch mental. Hier findest du Tipps und wichtige Informationen, um den Übergang gut zu gestalten und neue Perspektiven zu entwickeln.
Welche Gründe es geben kann, die Selbstständigkeit aufzugeben
Es gibt viele gute Gründe, sich selbstständig zu machen – doch ebenso einige, die Selbstständigkeit aufzugeben. Zum Beispiel, weil es einfach nicht so geklappt hat wie erhofft. Vielleicht hattest du eine gute Idee, die aber in der Praxis nicht den gewünschten Effekt hatte – weil du nicht davon leben konntest oder es keinen Markt dafür gab. Wenn selbstständige Vorhaben nicht das nötige Geld einbringen, sind sie langfristig nicht tragbar. Zumindest nicht, wenn du keine finanziellen Reserven oder einen gutverdienenden Partner an deiner Seite hast. Wirtschaftliche Schwierigkeiten sind ein häufiger Grund für die Aufgabe der Selbstständigkeit.
Vielleicht stellst du auch fest, dass dir das selbstständige Arbeiten einfach nicht liegt. In der Selbstständigkeit ist eine gute Organisationsfähigkeit gefragt. Du musst diszipliniert sein und deine Zeit gut managen können. Und dich um Organisatorisches wie Rechnungen und Steuererklärungen kümmern – nicht jeder hat Lust darauf. Es kann auch sein, dass du mit der finanziellen Unsicherheit, die eine Selbstständigkeit mit schwankender Auftragslage fast immer mit sich bringt, nicht länger leben willst. Vielleicht sehnst du dich nach der Sicherheit eines angestellten Arbeitsverhältnisses, wünschst dir bezahlte Urlaubstage (und Urlaub ohne Stress vorher und nachher) und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.
Wenn die Selbstständigkeit keine Perspektive bietet
Möglicherweise fühlst du dich auch überfordert, bist ständig im Stress oder arbeitest zu viel. Wenn die Selbstständigkeit körperliche und psychische Folgen hat, die du nicht länger ignorieren kannst, ist das ein guter Grund, die Selbstständigkeit aufzugeben, bevor es zum Burn-out kommt.
Es kann auch sein, dass sich deine persönlichen Umstände verändert haben. Vielleicht hast du eine Familie gegründet und brauchst jetzt einen Job, der dir mehr Geld oder mehr Sicherheit bietet. Oder deine Lebensziele sind nicht mehr dieselben wie zu dem Zeitpunkt, als du mit deiner Selbstständigkeit begonnen hast.
Nicht zuletzt kann es sein, dass du keine Perspektive in deiner Selbstständigkeit siehst. Keine Möglichkeiten, zu wachsen, dich weiterzuentwickeln – oder mehr Geld zu verdienen als bisher. Auch in solchen Fällen denken viele Selbstständige darüber nach, der Selbstständigkeit den Rücken zu kehren.
Aufgabe der Selbstständigkeit: Emotionale Aspekte und wie du damit umgehen kannst
Viele Selbstständige haben sich ganz bewusst für diesen Weg entschieden. Ihn wieder aufzugeben, kann emotional schwierig sein. Nicht selten zerplatzt dabei ein großer Traum – und der Weg zurück in ein angestelltes Arbeitsverhältnis erscheint zwar richtig, löst aber nicht nur positive Gefühle aus. Es ist wichtig, das Ende der Selbstständigkeit nicht nur organisatorisch in Angriff zu nehmen, sondern auch mental zu verarbeiten.
Dabei kann die Aufgabe der Selbstständigkeit von vielen Gefühlen begleitet sein: Vielleicht bist du traurig, aber gleichzeitig erleichtert. Vielleicht hast du das Gefühl, gescheitert zu sein, oder fühlst dich nicht gut genug. Oder vielleicht hast du innerlich auch längst akzeptiert, dass es so nicht weitergeht, und freust dich auf einen Neuanfang. Egal, wie deine Gefühle sind: Setze dich damit auseinander. Nimm dir Zeit für Reflexion, um unbelastet nach vorne schauen zu können.
Dabei ist es wichtig, dass du Mitgefühl mit dir und deinen Empfindungen hast. Akzeptiere, wie deine Gefühle sind – es gibt keine richtigen oder falschen Emotionen. Alle Emotionen haben ihre Berechtigung. Entscheidend ist, dass du sie verarbeitest. Wie du mit deinen Gefühlen umgehen kannst und was hilfreich ist, hängt davon ab, was vorherrschend ist:
- Traurigkeit: Traurig darüber zu sein, dass es mit der Selbstständigkeit nicht so geklappt hat wie erhofft, ist ganz normal. Gib dir die Erlaubnis, diese Traurigkeit zu fühlen. Es hilft, dich lieben Menschen anzuvertrauen oder deine Gedanken zu notieren. Auch ein symbolischer Abschied von der Selbstständigkeit kann als Abschluss hilfreich sein.
- Das Gefühl, gescheitert zu sein: Nur weil du etwas nicht für immer machst, heißt das nicht, dass du gescheitert bist. Aus jeder Erfahrung kannst du lernen, dich mit jedem Vorhaben weiterentwickeln. Ein Perspektivwechsel kann helfen, wenn du das Gefühl hast, versagt zu haben. Mit deiner Selbstständigkeit hast du gezeigt, dass du mutig bist und bereit, Verantwortung zu übernehmen – das ist mehr, als manche andere von sich sagen können.
- Erleichterung: Vielleicht sind es gar keine negativen Gefühle, die die Abkehr von der Selbstständigkeit begleiten. Vielleicht fühlst du dich erleichtert – so, als sei dir eine Last von den Schultern genommen worden. Wenn das so ist, umso besser: So kannst du den Blick unbeschwert nach vorne richten.
- Angst vor dem, was kommt: Es ist ganz normal, Ängste zu haben, wenn die Zukunft ungewiss ist. Du solltest dich davon aber weder lähmen lassen noch dich deshalb vor unbequemen Entscheidungen drücken. Um deine Ängste zu überwinden, hilft es, eine Perspektive zu entwickeln und dir einen Plan zu machen. Das gibt dir mehr Sicherheit und du hast etwas, was du Schritt für Schritt umsetzen kannst.
Formale Schritte: Was du tun musst, um deine Selbstständigkeit zu beenden
Wenn du sicher bist, dass du die Selbstständigkeit aufgeben möchtest, ist die Zeit gekommen, Nägel mit Köpfen zu machen. Hierzu sind einige formale Schritte gefragt. Bevor du von der Selbstständigkeit zurück ins Angestelltenverhältnis gehen kannst, musst du zum Beispiel dein Gewerbe abmelden, soweit du Gewerbetreibender bist. Wende dich dazu an das zuständige Gewerbeamt. Die Abmeldung kann in der Regel persönlich, schriftlich und oft auch online erfolgen. Du brauchst dafür deinen Personalausweis und gegebenenfalls einen Auszug aus dem Handelsregister.
Als Freiberufler musst du deine selbstständige Tätigkeit beim Finanzamt abmelden. Bei einem Wechsel von der Selbstständigkeit in ein Angestelltenverhältnis muss das Finanzamt informiert werden. Das erledigst du am besten schriftlich unter Angabe deiner Steuernummer und des Datums, an dem du deine Selbstständigkeit aufgegeben hast.
In steuerlicher Hinsicht solltest du beachten, dass du noch eine abschließende Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst (soweit du umsatzsteuerpflichtig bist). Dasselbe gilt für die Einkommensteuererklärung und gegebenenfalls eine Gewerbesteuererklärung für das letzte Jahr deiner Selbstständigkeit.
Informieren solltest du beim Wechsel von der Selbstständigkeit in eine Festanstellung auch deine Krankenversicherung. Durch die Veränderung deiner beruflichen Tätigkeit kann sich deine Tarifgruppe ändern. Möglicherweise gibt es Versicherungen, die angepasst oder gekündigt werden müssen, etwa eine Berufshaftpflicht oder Betriebshaftpflichtversicherung.
Verträge kündigen, Kunden informieren
Bei einer Pflichtmitgliedschaft in der Industrie- und Handelskammer (IHK) oder der Handwerkskammer (HWK) musst du diese Mitgliedschaft mit der Aufgabe deiner Selbstständigkeit beenden. In der Regel geschieht das automatisch, wenn du dich beim Gewerbeamt abgemeldet hast – im Zweifel kann es sich aber lohnen, sich direkt an die zuständige Kammer zu wenden.
Gibt es Verträge oder Konten, die geändert oder gekündigt werden müssen? Das kann zum Beispiel ein Geschäftskonto betreffen, die Miete von Geschäftsräumen oder Webhosting-Verträge. Falls du eine Webseite hast, nimm sie vom Netz oder aktualisiere sie entsprechend.
Was ist mit der Rente? Angenommen, du bist nach der Selbstständigkeit wieder angestellt: Die Rentenversicherung ist dann in der Regel automatisch abgedeckt. Du und dein Arbeitgeber zahlt dann jeweils die Hälfte der Beiträge. Auch in der Arbeitslosigkeit bist du rentenversichert, allerdings nur beim regulären Arbeitslosengeld. Bei einem Bürgergeldbezug führt das Jobcenter keine Beiträge an die Rentenversicherung ab, freiwillige Beiträge sind jedoch möglich.
Nicht zuletzt ist es wichtig, Geschäftspartner und Kunden auf dem Laufenden zu halten. Engere und regelmäßige Kontakte solltest du persönlich darüber informieren, dass du deine Selbstständigkeit beendest – so bleibst du professionell in Erinnerung.
Berufliche Neuorientierung nach der Selbstständigkeit: Welche Optionen habe ich?
Wenn du bislang nur mit dem Gedanken spielst, deine Selbstständigkeit aufzugeben, kann die Zukunft ungewiss sein: Was kommt nach der Selbstständigkeit? Es ist sinnvoll, sich frühzeitig mit seinen Optionen auseinanderzusetzen. Das hilft dir nicht nur, Leerlauf zu vermeiden – es gibt dir auch Sicherheit. Es ist beruhigend, zu wissen, was danach kommen kann.
Eine naheliegende Variante ist der Wechsel von der Selbstständigkeit in ein Angestelltenverhältnis. Von der Selbstständigkeit in eine Festanstellung zu wechseln, bringt viele Vorteile mit sich: Du hast wieder ein gesichertes, regelmäßiges Einkommen, bist auch sozial abgesichert und hast einen klar strukturierten Alltag. Außerdem trägst du deutlich weniger Verantwortung. Du könntest zum Beispiel in deinen früheren Beruf zurückkehren – auf eine einfache Position oder als Führungskraft. Auch ein Quereinstieg in verwandte Tätigkeitsfelder kann infrage kommen.
Eine weitere Option besteht darin, die Selbstständigkeit gar nicht dauerhaft aufzugeben, sondern nur eine neue Richtung einzuschlagen. Du könntest nach neuen unternehmerischen Projekten Ausschau halten, die lukrativer sind oder besser zu dir passen. Dabei könntest du deinen selbstständigen Vorhaben auch in Teilzeit nachgehen und dir als Ergänzung eine Festanstellung suchen.
Coaching oder Beratung nutzen
Vielleicht ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt für eine Weiterbildung oder Umschulung. Neues Wissen und zusätzliche Kompetenzen können dir Türen öffnen. Du kannst dich spezialisieren oder dir Kenntnisse aus einem anderen Bereich aneignen. Auch Zertifikate können hilfreich sein, um nach einer Weiterbildung schnell auf dem Arbeitsmarkt fündig zu werden.
Womöglich stellt die Aufgabe der Selbstständigkeit einen tiefgreifenden Umbruch für dich dar. Falls damit eine tiefere Krise verbunden ist, spricht vieles dafür, dich grundlegend mit dir und deinen beruflichen Zielen und Vorstellungen auseinanderzusetzen. Dabei können dir Gespräche mit Menschen aus deinem privaten Umfeld ebenso helfen wie ein professionelles Coaching.
Beraten lassen kannst du dich übrigens auch bei der Agentur für Arbeit (oder dem Jobcenter). Oder du wendest dich an eine Fachgruppe oder dein eigenes berufliches Netzwerk. Letzteres kann aussichtsreich sein: Oft findet sich durch persönliche Kontakte schnell eine neue spannende Stelle.
Stärken aus der Selbstständigkeit bei Bewerbungen nutzen
Nicht wenige Menschen, die ihre Selbstständigkeit aufgeben, empfinden diesen Umstand bei Bewerbungen als Makel. Dabei muss es gar kein Nachteil sein, wenn du bislang selbstständig warst. Entscheidend ist, die Stärken zu sehen, die du in deiner Selbstständigkeit gezeigt hast, und sie bei der Jobsuche deutlich zu machen.
Sich überhaupt selbstständig zu machen, erfordert bestimmte Soft Skills. Typische Stärken von Selbstständigen sind etwa Durchhaltevermögen, Selbstmarketing, Kommunikationsstärke, Organisation und Problemlösungsfähigkeiten. Du bist eigenverantwortliches Arbeiten gewöhnt und orientierst dich in deiner Arbeit an den Bedürfnissen deiner Zielgruppe. All diese Fähigkeiten kannst du auch in einem angestellten Arbeitsverhältnis gewinnbringend einbringen. Rücke sie also in den Vordergrund – zum Beispiel durch entsprechende Beispiele in deinem Bewerbungsschreiben.
Statt deine Selbstständigkeit unter den Teppich kehren zu wollen, solltest du sie selbstbewusst in deinem Lebenslauf und Anschreiben darstellen. In jedem Fall darf sie als Station im Lebenslauf nicht fehlen. Wie bei angestellten Jobs bietet es sich an, eine kurze Beschreibung typischer Tätigkeiten zu ergänzen. Hier kannst du deine Stärken ebenfalls verdeutlichen.
Entscheidend ist, dass es dir gelingt, die Stärken aus deiner Selbstständigkeit auf den Job zu beziehen, für den du dich bewirbst. Schlage den Bogen von dem, was du bisher gemacht hast, zur anvisierten neuen Stelle. Wenn du das überzeugend tust, kannst du deine Chancen entscheidend verbessern.
In Vorstellungsgesprächen ist es ebenso wichtig, souverän und proaktiv auf deine Selbstständigkeit zu sprechen zu kommen. Stelle dich auf Rückfragen ein – deine Gesprächspartner wollen womöglich wissen, warum du deine Selbstständigkeit aufgegeben hast. Überlege dir vorab, welche positiven Schlüsse du aus deiner Selbstständigkeit ziehen kannst und wie du das kommunizieren kannst.
Selbstständigkeit aufgeben: Finanzielle Aspekte
Die Aufgabe der Selbstständigkeit kann verschiedene finanzielle Aspekte mit sich bringen, die du bedenken solltest. Das gilt zum Beispiel, wenn du nicht von der Selbstständigkeit zurück ins Angestelltenverhältnis wechselst, sondern noch nicht weißt, was danach kommt. In solchen Fällen ist es wichtig, den Anspruch auf Arbeitslosengeld zu prüfen.
Das Problem: Als Selbstständiger hast du wahrscheinlich nicht in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt, es sei denn, du hast es freiwillig getan. Andernfalls besteht kein Anspruch auf Arbeitslosengeld, wenn du deine Selbstständigkeit aufgibst. Stattdessen hast du die Möglichkeit, Bürgergeld zu beantragen, wenn deine Einkünfte beziehungsweise deine Rücklagen nicht für die Finanzierung deines Lebensunterhalts reichen.
In jedem Fall solltest du dich möglichst frühzeitig an das zuständige Amt wenden und die jeweiligen Leistungen beantragen, um finanziell nach dem Ende deiner Selbstständigkeit abgesichert zu sein.
Was, wenn das Geld nicht reicht?
In der Übergangszeit ist es wichtig, deine geschäftlichen und privaten Finanzen zu trennen, um den Überblick zu behalten. Wenn du ein Geschäftskonto hast: Kündige es, wenn du es nicht mehr benötigst. Zahle offene Rechnungen und lege dir Geld für Steuern, Versicherungen und mögliche Schulden zurück.
Für deine privaten Finanzen ist ein Haushaltsplan hilfreich. Darin verzeichnest du alles, was du Monat für Monat brauchst. Auch deine Ausgaben solltest du aufschreiben – so hast du nicht nur alles im Blick, sondern kannst auch Einsparpotenzial leichter erkennen. Es kann während einer finanziellen Durststrecke hilfreich sein, bestimmte Ausgaben zu verringern, zum Beispiel für Abos oder Versicherungen.
Was, wenn das Geld (zu) knapp ist, nachdem du deine Selbstständigkeit aufgegeben hast? Dann ist es wichtig, frühzeitig aktiv zu werden. Nimm Hilfe in Anspruch – zum Beispiel in Form einer Beratung beim Jobcenter oder der Agentur für Arbeit, bei einer Schuldnerberatung, der IHK (oder HWK) oder Existenzgründerzentren.
Nach der Selbstständigkeit: Perspektiven und neue Chancen
Nach der Selbstständigkeit beginnt ein neuer Abschnitt. Die Übergangsphase ist oft mit vielen Unsicherheiten behaftet, aber im Neuanfang liegt auch eine Chance. Der Abschied von der Selbstständigkeit kann emotional belastend sein, weshalb es wichtig ist, nichts zu überstürzen und dir ausreichend Raum zu geben, alles zu verarbeiten.
Neu anzufangen, muss nicht bedeuten, bei null anzufangen. Vielleicht könntest du wieder bei einem früheren Arbeitgeber anfangen oder anderweitig an das anknüpfen, was du beruflich gemacht hast. Dabei ist deine Selbstständigkeit keinesfalls eine verlorene Zeit. Im Gegenteil: Du hast wertvolle Erfahrungen gesammelt, die dich auszeichnen – zum Beispiel im Hinblick auf deine Organisationsfähigkeit, Problemlösungskompetenz und unternehmerisches Denken. Vielleicht hast du Rückschläge erlebt, die dich widerstandsfähiger gemacht haben.
Nutze die Chance, aus deinen Fehlern zu lernen. Es ist eine wichtige Erfolgsgrundlage, zu wissen, wie es nicht geht. Egal, ob du dir nach deiner Selbstständigkeit einen sicheren angestellten Job suchst oder aber überlegst, es mit einem anderen selbstständigen Vorhaben zu versuchen.
Bei alldem ist es wichtig, dass du trotz aller Zweifel oder negativen Gefühle optimistisch bleibst. Schaue hoffnungsvoll in die Zukunft, indem du deinen Blick gezielt auf die Chancen richtest, die du jetzt hast. Dazu ist Resilienz essenziell. Die dürftest du haben, denn sicherlich hast du viele unsichere Phasen in deiner Selbstständigkeit erlebt und musstest Hindernisse überwinden. Mache dir klar, wo deine Stärken liegen, um dich mental optimal auf die neue Lebensphase vorzubereiten – und den Neuanfang mit voller Kraft zu gestalten.
Selbstständigkeit beenden: Wo finde ich Unterstützung?
Es kann sich beängstigend anfühlen, die Selbstständigkeit aufzugeben. Doch keine Sorge: Du bist damit nicht allein – wenn du Hilfe möchtest oder einfach das Gefühl, dass jemand an deiner Seite ist, gibt es viele Anlaufstellen. Das kann zum Beispiel dein privates Umfeld sein. Deine Freunde, dein Partner, deine Eltern oder Geschwister – solche Menschen kennen dich und können dich emotional auffangen. Sie können dir auch dabei helfen, neue Perspektiven zu entwickeln.
Auch professionelle Beratungsangebote können sich anbieten. Du kannst dich zum Beispiel an die Agentur für Arbeit wenden, wenn du dich zu deinen Optionen für die berufliche Neuorientierung beraten lassen möchtest. Es gibt auch viele Beratungsstellen für Selbstständige, etwa bei der IHK oder Handwerkskammer oder in einem Gründerzentrum.
Um dich optimal auf deine berufliche Zukunft vorzubereiten, können Coaches oder Mentoren hilfreich sein. Karriereberater helfen dir dabei, deine Stärken und Potenziale ebenso klar zu sehen wie deine beruflichen Optionen.
Auch der Austausch mit anderen (ehemaligen) Selbstständigen kann dich in dieser Phase auffangen. Dafür bieten sich Online-Communities an. Möglicherweise kennst du auch jemanden persönlich, der schon ähnliche Erfahrungen gemacht hat – dann könntet ihr euch direkt austauschen. So eine Person kann dir Tipps geben und dir Mut machen in einer ungewissen, oft schwierigen Zeit.
Bildnachweis: baranq / Shutterstock