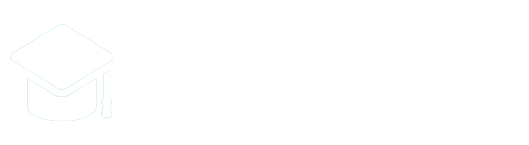Die Kunst der Balance: So entwickelst du ein gesundes Anspruchsdenken
„Das steht mir zu!“ Eine solche Grundhaltung kann ein Anzeichen für eine Anspruchshaltung sein. Hier erfährst du, woran du Anspruchsdenken erkennst, wie es entsteht und wie du realistische Erwartungen entwickeln kannst.
Anspruchsdenken: Was ist das eigentlich?
Manche Menschen haben ein Anspruchsdenken. Man spricht dann auch von einer Anspruchshaltung: Sie sind überzeugt, dass ihnen bestimmte Dinge zustehen. Zum Beispiel eine Beförderung im Job, ein eigenes Haus oder eine bestimmte Behandlung durch andere. Diese Erwartungen sind nicht nur überzogen, sondern auch unangemessen, denn die betreffende Person hat zwar das Gefühl, etwas „verdient“ zu haben – eingesetzt hat sie sich dafür aber nicht. Jedenfalls nicht in einem Maße, durch das ein Anspruch wirklich gegeben wäre.
Damit unterscheidet sich Anspruchsdenken fundamental von berechtigten Forderungen und einem gesunden Selbstbewusstsein. Berechtigte Ansprüche haben eine klare Grundlage, zum Beispiel, weil jemand eine bestimmte Leistung erbracht hat. Eine Anspruchshaltung hingegen beruht auf dem oft eher diffusen Gedanken, dass man es einfach verdient habe, dass sich bestimmte Dinge ergeben. Eine Basis für diese Annahme gibt es nicht.
Anspruchsdenken ist in der Psychologie mit verschiedenen Hintergründen und Faktoren verknüpft. Bestimmte Erfahrungen, oft bereits in der Kindheit durch Erziehung und das Verhalten der Eltern, können ein Anspruchsdenken wahrscheinlicher machen. Kinder, die alle Wünsche erfüllt bekommen, können das Gefühl entwickeln, dass ihnen alles zusteht, ohne dass sie sich darum ernsthaft bemühen müssen. Auch kulturelle und gesellschaftliche Einflüsse sowie Medien können eine Anspruchshaltung befördern, weil sie unrealistische Vorstellungen erzeugen können.
Diese Anzeichen deuten auf ein erhöhtes Anspruchsdenken hin
Um Anspruchsdenken handelt es sich, wenn jemand Forderungen stellt – implizit oder explizit –, ohne dafür eine Gegenleistung erbracht oder Verantwortung übernommen zu haben. Im Alltag zeigt sich eine Anspruchshaltung häufig subtil. Wer die betreffenden Personen beobachtet, wird aber immer wieder Anzeichen für Anspruchsdenken bemerken.
Die Betroffenen haben überzogene Erwartungen an ihre Umwelt, ohne dabei zu reflektieren, inwieweit sie selbst sich verdient gemacht oder eingebracht haben. Ein Beispiel aus dem Job: Jemand erwartet dann vielleicht, dass er nach gewisser Zeit automatisch befördert wird, ganz egal, ob er besondere Leistungen erbracht hat oder nicht. Oder ein Student wundert sich über mittelmäßige Noten, obwohl er sich mit dem Stoff befasst hat (allerdings nicht genug).
Ein Anspruchsdenken offenbart sich häufig im Umgang mit Feedback und Kritik. Wer konstruktive Rückmeldungen sofort als persönlichen Angriff wertet und darauf beleidigt reagiert, ist offensichtlich wenig bereit zu Selbstreflexion. Häufig glauben die Betroffenen, grundsätzlich alles richtig zu machen. Wenn es nicht so läuft wie erhofft, sind meist die anderen schuld – oder die Umstände.
Junge Berufseinsteiger mit Anspruchshaltung fallen oft durch überzogene Gehaltsvorstellungen auf. Sie können sich für bestimmte Tätigkeiten zu schade sein oder haben das Gefühl, sofort eine Top-Position verdient zu haben – zum Beispiel, weil sie gute Noten im Studium hatten.
Dabei ist es wichtig, zu unterscheiden: Nicht jede Form von Ansprüchen ist mit einem Anspruchsdenken verbunden. Wenn sich jemand engagiert hat, stellt er womöglich zu Recht Ansprüche. Entscheidend ist, in welchem Verhältnis Einsatz und Erwartungen zueinander stehen: Wer viel fordert, sollte auch bereit sein, Verantwortung zu zeigen.
Warum entwickeln manche Menschen ein Anspruchsdenken?
Manche Menschen haben überzogene Ansprüche. Woran liegt das? Warum entwickelt jemand eine Anspruchshaltung? Eine solche Grundhaltung entsteht in der Regel nicht zufällig, sondern durch eine Kombination aus verschiedenen Faktoren. Eine wichtige Rolle spielen die Erziehung, persönliche Faktoren und gesellschaftliche Einflüsse.
Kindheitserfahrungen sind oft zentral für die Entstehung von Anspruchsdenken. Eltern, die ihrem Kind jeden Wunsch sofort erfüllen, die ihr Kind vor Konflikten und unangenehmen Situationen übermäßig schützen, vermitteln ihm unbewusst: Anstrengung ist nicht nötig. Andere regeln das für dich. Setzt sich ein solches Muster über Jahre fort, gewöhnen sich die Kinder daran, dass ihr Einsatz nicht nötig ist, um etwas zu erreichen. Das kann in Schule, Ausbildung oder Job zu übersteigerten Erwartungen führen.
Eine Anspruchshaltung bei jungen Menschen kann durch den Einfluss von sozialen Medien verstärkt werden. Durch perfekte Inszenierungen wirkt es oft so, als hätten andere ein durch und durch wunderbares, sorgenfreies Leben, ohne dafür groß etwas tun zu müssen. Das kann den Eindruck erwecken, man selbst habe das ebenfalls verdient. Dabei wird leicht übersehen, dass Posts bei Instagram und Co erstens mit der Realität wenig gemein haben müssen und zweitens oft das Ergebnis harter Arbeit sind.
Der Einfluss der Überflussgesellschaft
In unserer modernen Gesellschaft leben wir im Überfluss. Viele Dinge sind nur einen Mausklick entfernt. Das kann das Bedürfnis nach sofortigem Erfolg verstärken: Die Betroffenen wollen sofort das erreichen, was ihnen vorschwebt. Die nötige Geduld, Frustrationstoleranz und Durchhaltevermögen bringen sie nicht mit, was an ihren Ansprüchen nichts ändert.
Nicht zuletzt spielt die Persönlichkeit eine Rolle. Wer sein Selbstbild stark von der Anerkennung anderer oder der eigenen beruflichen Position abhängig macht, neigt beispielsweise eher zu überhöhten Erwartungen. Auch ein niedriges Selbstwertgefühl kann durch Anspruchsdenken kompensiert werden: Innere Unsicherheit wird manchmal durch äußere Ansprüche kaschiert.
Wie sich überzogene Ansprüche auswirken können – für die Betroffenen und ihr Umfeld
Anspruchsdenken hat Folgen – für die Personen, die es haben, ebenso wie für ihr Umfeld. Eine häufige Folge einer Anspruchshaltung sind enttäuschte Erwartungen und Frust. Überhöhte Erwartungen können oft nicht erfüllt werden, jedenfalls nicht ohne den nötigen Einsatz. Dadurch können die Betroffenen unzufrieden sein. Sie fühlen sich womöglich unfair behandelt – auch dann, wenn ihnen objektiv betrachtet keine Ungerechtigkeit widerfahren ist.
Im beruflichen Kontext kann Anspruchsdenken zu Konflikten mit Kollegen und Vorgesetzten führen. Haben einzelne Mitarbeiter das Gefühl, sie seien mehr wert als andere, fühlen sie sich schnell benachteiligt oder halten Aufgaben für unter ihrer Würde, kann das Spannungen schaffen. Andere können eine solche Haltung als egoistisch und überheblich empfinden, womit sich die Betroffenen keine Freunde im Team machen. Auch für Führungskräfte ist es eine Herausforderung, wenn Mitarbeiter mehr erwarten, als sie leisten, und Kritik übergehen.
Menschen mit Anspruchsdenken sind oft wenig kompromissbereit. Sie tun sich schwer damit, zugunsten der Interessen und Bedürfnisse anderer zurückzustecken. Entscheidungen, die ihren Erwartungen nicht entsprechen, nehmen sie oft persönlich, statt zu akzeptieren, dass sie insgesamt der richtige Weg sind.
Eine Anspruchshaltung kann die Betroffenen zunehmend isolieren, egal, ob im Team oder im privaten Umfeld. Wer ständig fordert, aber selbst wenig gibt, stößt andere vor den Kopf. Er droht, an Ansehen zu verlieren und aus sozialen Kreisen ausgeschlossen zu werden.
Im Job oder Studium kann ein Anspruchsdenken auch dazu führen, dass sich die Betroffenen überfordern oder sogar ein Burn-out entwickeln. Das kann der Fall sein, wenn sie sich großen Druck machen, „besonders“ oder „außergewöhnlich“ sein zu müssen. Häufig glauben die Betroffenen, sie müssten bestimmte Dinge erreichen, um etwas wert zu sein. Ist das nicht der Fall, kann ihr Selbstbild darunter leiden.
Gesundes Selbstbewusstsein oder doch Anspruchsdenken – wo ist der Unterschied?
Wer Erwartungen hat und Ansprüche stellt, muss kein Anspruchsdenken haben. Wo liegen die Grenzen zwischen realistischen Vorstellungen, die selbstbewusst geäußert werden, und überzogenen Ansprüchen, die nicht begründet sind? Zwischen beidem gibt es entscheidende Unterschiede. Sie betreffen die Grundhaltung der Betroffenen ebenso wie ihre Motivationund Persönlichkeitsstruktur.
Ein gesundes Selbstbewusstsein zu haben, bedeutet, für sich einzustehen. Das heißt aber nicht, dass man gleichzeitig andere abwerten oder sich über sie stellen würde. Man sieht sich auch nicht rein positiv, sondern betrachtet die eigenen Stärken und Schwächen realistisch. Herausforderungen nimmt man an, ist aber im Gegenzug bereit, die nötige Verantwortung zu übernehmen und Einsatz zu erbringen. Auf Kritik reagieren viele Menschen mit gesundem Selbstbewusstsein, indem sie diese annehmen und versuchen, daraus zu lernen. Zugleich wissen sie: Erfolge, Leistungen und Anerkennung sind das Resultat von Einsatz, persönlicher Entwicklung und Durchhaltevermögen.
Bei einem Anspruchsdenken ist das anders: Die Betroffenen haben hohe Erwartungen an andere, übernehmen aber selbst wenig Verantwortung. Mitunter werden sie ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht, setzen sich damit aber gar nicht auseinander – sie fordern also von anderen, was sie selbst nicht bereit sind, zu leisten. Typisch ist der Gedanke, bestimmte positive Entwicklungen verdient zu haben – aber nicht, weil man sich so ins Zeug gelegt hätte, sondern weil man „es wert ist“. Kritik stößt bei den Betroffenen häufig auf Ablehnung und wird persönlich genommen. Sie setzen sich wenig mit sich auseinander, wachsen deshalb auch nicht.
Wie entwickelt man realistische Ansprüche?
Wenn es um Ansprüche geht, ist Balance gefragt: Es ist einerseits wichtig, dass du klar formulierst, was du dir wünschst und was dir wichtig ist. Andererseits solltest du dabei nicht in eine Anspruchshaltung verfallen. Entscheidend ist, dass du gesunde Erwartungen an andere und dich selbst entwickelst. Hier erfährst du, wie dir das gelingen kann.
Selbstreflexion ist der Grundpfeiler von realistischen Ansprüchen. Setze dich mit einem Wunsch oder Bedürfnis auseinander: Warum hast du diesen Wunsch, dieses Bedürfnis? Inwieweit hast du es „verdient“, weil du dich engagiert hast? Basiert dein Anspruch auf Erfahrungen oder Fähigkeiten, die du tatsächlich hast? Wenn du deine Stärken und Schwächen kennst, kannst du besser einschätzen, was realistisch ist.
Mache dabei nicht den Fehler, Wünsche und Ansprüche miteinander zu verwechseln. Natürlich ist es schön, wenn sich die Dinge so entwickeln, wie du es gehofft hast. Das heißt aber nicht, dass du einen Anspruch auf Erfolg hättest. Auch hier hilft Reflexion: Steht dir das wirklich zu? Auf welcher Grundlage?
Es ist sinnvoll, wenn du dir nicht nur Ziele setzt, sondern sie mit einem konkreten Plan verknüpfst. Was wirst du tun, um deine Ziele zu erreichen? Je mehr du erreichen möchtest, desto mehr musst du bereit sein, zu geben. Dazu gehört auch, auf Hindernisse und Rückschläge vorbereitet zu sein. Wer trotzdem dranbleibt, hat öfter Erfolg. Geduld und Ausdauer sind wichtige Werte, wenn es darum geht, aus Wünschen Realität werden zu lassen.
Ein wichtiger Bestandteil von realistischen Ansprüchen ist Frustrationstoleranz. Es kann nicht immer alles nach Plan laufen, egal, wie sehr du dich ins Zeug legst. Misserfolge gehören dazu. Entscheidend ist dein Umgang damit: Anstatt dich darüber zu ärgern oder den Mut zu verlieren, solltest du Rückschläge als Chance sehen, aus Fehlern zu lernen und als Person zu wachsen. Aus demselben Grund ist es wichtig, Feedback von anderen anzunehmenund sich damit auseinanderzusetzen, statt beleidigt zu reagieren.
Tipps zum Umgang mit Anspruchsdenken – bei dir selbst und bei anderen
Im Umgang mit Anspruchsdenken ist Feingefühl gefragt. Dabei ist es egal, ob es um deine eigenen überzogenen Erwartungen geht oder ob dich die Anspruchshaltung anderer Menschen belastet – zum Beispiel von Kollegen, dem Partner oder Angehörigen.
Der erste Schritt besteht darin, eigene Erwartungen als solche klar zu sehen. Achtsamkeit hilft dir dabei. Nicht immer ist einem bewusst, welche Ansprüche man implizit stellt – an andere Menschen oder einfach „das Leben“ im weiteren Sinne. Indem du deine Erwartungen hinterfragst und deine Stärken und Schwächen ehrlich betrachtest, kannst du überzogene Ansprüche erkennen und bewusst ablegen.
Es ist außerdem hilfreich, dich nicht zu sehr mit anderen zu vergleichen. Du bist nicht dein Kollege und schon gar nicht die Influencerin bei Instagram. Ein ständiger sozialer Vergleich kann eigene Ansprüche verzerren. Konzentriere dich lieber auf dich selbst, statt dich zu stark an anderen zu orientieren – und daraus unrealistische Erwartungen abzuleiten.
Wie reagieren auf überhöhte Erwartungen bei anderen?
Was, wenn andere überzogene Ansprüche haben? Dann kann es wichtig sein, ihnen Grenzen zu setzen. Dazu kannst du höflich, aber bestimmt deutlich machen, was andere von dir verlangen können und was nicht. Indem du respektvoll, aber klar kommunizierst, kannst du mehr Balance erreichen und für deine Bedürfnisse einstehen.
Scheue dich nicht, andere auf ihr Anspruchsdenken anzusprechen. Entscheidend ist allerdings, in welchem Ton und mit welchen Worten du das tust. Du solltest dir davon außerdem etwas Konkretes versprechen, zum Beispiel eine einfachere Zusammenarbeit mit einer Kollegin, mit der du eng zusammenarbeiten musst. Sei darauf vorbereitet, dass die betreffende Person nicht glaubt, überhöhte Ansprüche zu haben.
Im Umgang mit Menschen mit Anspruchsdenken ist Einfühlungsvermögen wichtig. Viele Betroffene sind in Wahrheit unsicher. Wenn du empathisch mit solchen Menschen umgehst, reduzierst du das Konfliktrisiko. Du gibst den Betroffenen das Gefühl, gesehen und gehört zu werden, was eure Beziehung verbessern und sich positiv auf deren Verhalten auswirken kann.
Bildnachweis: fizkes / Shutterstock